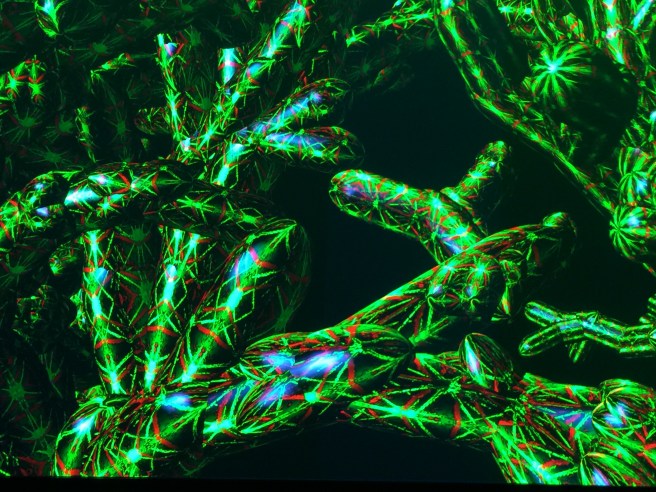„Angesichts der unverantwortlichen Haltung, die der ADAC bei der Diskussion um eine Tempolimitierung auf den Bundesautobahnen einnimmt, ist mir eine weitere Mitgliedschaft in Ihrem Club aus moralischen Gründen nicht möglich.“ Mein Schreiben datiert vom 28.02.1974 und wurde vom ADAC wortreich beantwortet. Überzeugen konnten mich die Argumente nicht, und seither bekomme ich auch die ADAC Motorwelt nicht mehr zugeschickt. Die findet jetzt kein Mitglied mehr in seinem Briefkasten. Im neuen Jahr gibt’s das Zentralorgan der Automobilisten nur noch einmal im Quartal; dafür müssen die in einen Netto-Markt oder in eine Clubfiliale fahren: dort können sie ihr Magazin dann abholen. Damit einher geht eine massive Reduzierung der Auflagen. Der reiche Verein muss sparen.
Ging es damals um die Sicherheit im Straßenverkehr, geht es heute in erster Linie um die Umwelt. Greenpeace schätzt, dass mit einem Tempolimit in Deutschland bis zu 5 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden können, ohne dass diese Maßnahme auch nur einen Cent kosten würde. Was den Amerikanern die Schusswaffen, sind den Deutschen ihre schnellen Autos. Selbst Die Grünen wollen diese heilige Kuh nicht ernsthaft schlachten, niemand traut sich, diesen deutschen Sonderweg zu beenden, die Auto-Kanzlerin erst recht nicht. In allen anderen Ländern dieser Welt rollt der Verkehr entspannter & klimafreundlicher, wir rollen bei Fahrten im Ausland einfach mit und finden es dann ganz toll.
Für eine Reduzierung des CO2-Verbrauchs sind mittlerweile alle: es soll sich nur nichts ändern, und kosten darf es auch nichts. Natürlich auch die Freunde von der SPD, die traditionell gute Beziehungen zur Arbeiterwohlfahrt (AWO) pflegen. Die unglaublichen Verhältnisse in den Kreisverbänden Frankfurt und Wiesbaden erschüttern derzeit die Glaubwürdigkeit dieses Verbandes der Freien Wohlfahrtspflege im Rhein-Main-Gebiet – und finden bundesweit Beachtung. Ohnehin schon fürstlich entlohnte Führungskäfte bekamen noch Dienstwagen mit vielen hundert PS gestellt und schrieben nebenbei noch fette Honorar-Rechnungen. Auch die Frau des Frankfurter OB Peter Feldmann, der seine Brötchen einst bei der AWO verdiente, profitiert von dieser Wohlfahrt in eigener Sache. Ihr Gehalt als Leiterin einer KITA ist überdurchschnittlich hoch, und sie fährt einen Dienstwagen; davon will ihr Mann überhaupt nichts bemerkt haben. Sein SPD-Kollege in Hannover, Stefan Schostok, ist über eine ähnliche Affäre gestolpert und muss jetzt seinen Ruhestand genießen. Hochmut kommt vor dem Fall. Welcome to Small Britain, Mr. Johnson!